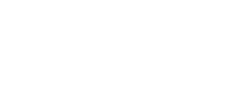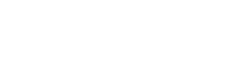Ehrenamt sozial und fair gestalten
Verfasst von Arne Bode
Über 23 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland in den verschiedensten Bereichen. Vom Engagement im lokalen Fußballverein über die Betreuung und Integration von nach Deutschland migrierten Personen bis hin zur Rettung von Rehkitzen. Zusammengerechnet summiert sich das Engagement aller auf 4,6 Milliarden Stunden – eine beeindruckende Zahl!
Aber: Was genau versteht man unter Ehrenamt in Deutschland? Wo stößt das Ehrenamt an seine Grenzen? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es für Dich und Deine Organisation?
In diesem Artikel haben wir grundlegendes zu den Rahmenbedingungen von Engagement in Deutschland zusammengefasst. Du erhältst außerdem Infos, wie Du Dich für faire Strukturen im Ehrenamt stark machen und welche staatlichen Mittel Du in Anspruch nehmen kannst.

Inhaltsverzeichnis
Ehrenamt vs. freiwilliges Engagement
Eine feststehende Definition, was Ehrenamt bzw. freiwilliges Engagement genau bedeutet, gibt es nicht. Zentral ist beiden Begriffen lediglich, dass es sich dabei um eine freiwillige und am Gemeinwohl orientierte Arbeit handelt, die überwiegend unentgeltlich erfolgt. Darunter kann also ein breites Spektrum von Aktivitäten fallen, wie zum Beispiel das Mitmachen bei einem Clean-Up oder die 40-Stunden-Woche als ehrenamtlicher Vereinsvorstand.
Unter einem klassischen Ehrenamt wird traditionell eher eine Funktion oder ein offizielles Amt verstanden, z.B. als Schöff:in, Wahlhelfer:in oder Vorstandsmitglied eines Vereins.
Der Begriff des freiwilligen Engagements ist breiter gefasst und umfasst freiwillige Tätigkeiten in allen Bereichen der Gesellschaft.
Im Alltag verschwimmen die Begriffe jedoch und werden oft synonym verwendet. Ganz gleich ob von Ehrenamt oder freiwilligem Engagement die Rede ist: Herausfordernd wird es immer dann, wenn Geldzahlungen ins Spiel kommen oder das Ehrenamt einem Beschäftigungsverhältnis gleicht.
Ehrenamt vs. Sozialstaat
Es ist nicht unüblich, dass Engagierte auch grundlegende staatliche Versorgungsleistungen übernehmen. Beispiele dafür gibt es genug: in der Kinderbetreuung, bei Deutschkursen oder Übersetzungstätigkeiten, bei Fahrdiensten, in der Arbeit mit geflüchteten Menschen oder in der Pflege. Besonders Kommunen sind stark auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Daher werben sie verstärkt um Engagierte, die meist gegen eine geringe Aufwandsentschädigung bei kommunalen Versorgungsleistungen unterstützen. Das Ehrenamt wird so mancherorts zu einem Graubereich für informelle Tätigkeiten zwischen Erwerbstätigkeit und freiwilligem Engagement, in denen Freiwillige berufliche Tätigkeiten mit Gemeinwohlbezug (z.B. in der Pflege oder sozialen Arbeit) ohne entsprechende Ausbildung erfüllen.
Besonders für Menschen in prekären Lebenssituationen können Geldzahlungen motivierend wirken und das Ehrenamt für Einkommensschwache erst ermöglichen. Es birgt jedoch auch die Gefahr, Abhängigkeiten zu erzeugen, wenn Menschen auf diese Zuzahlungen angewiesen sind, anstatt eine ausreichende Rente oder Vergütung durch den Mindestlohn zu erhalten. Dies ist v.a. der Fall, wenn es sich um pauschale Aufwandsentschädigungen, geringfügige Bezahlungen und Honorare handelt. Ehrenamt und freiwilliges Engagement sind in einer Demokratie unverzichtbar. Wenn Freiwilligen jedoch zu viel zugemutet wird oder Engagierte den Personalmangel in einigen Bereichen kompensieren müssen, dann wird Engagement als Ressource entfremdet.
Wieso betrifft das Dein Projekt?
Dein Engagement und das Deiner Mit-Freiwilligen ist in erster Linie bewundernswert und toll. Nichtsdestotrotz sollte jede Organisation stets einen Blick darauf haben, welche Tätigkeiten von Ehrenamtlichen ausgeführt werden. Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass niemand an die eigene Belastungsgrenze stößt oder Abhängigkeiten entstehen.
Nachfolgend haben wir Dir einige Tipps zusammengestellt, mit denen Du die Engagementstrukturen in Deiner Organisation stärken kannst.